Für die meisten von uns ist die Stadt Athen praktisch der Inbegriff des antiken Griechenland. Wir denken an die markante Akropolis, Athens Ruf als „Wiege der Demokratie“ und natürlich die bis heute bekannten und berühmten Philosophen, Dichter und Denker, die aus Athen stammten. Dabei war Athen lange Zeit nur ein Stadtstaat unter vielen im antiken Griechenland und politisch nur während einer vergleichsweise kurzen Zeit wirklich bedeutsam. Zeit für einen Blick auf die Geschichte dieser berühmten Stadt.
Athen auf dem Höhepunkt
Die Akropolis ist ein imposantes Bauwerk, auch heute noch, obwohl wir davon nur noch Ruinen sehen können. Denkt man an das antike Griechenland, kommt einem sofort dieses Bauwerk in den Sinn. Man kann sogar noch weiter gehen: Denkt man an die europäische Antike generell, würde vielen sofort ein Bild dieses Bauwerks in den Kopf kommen.
Es stammt aus der Zeit, als die Stadt Athen auf dem Höhepunkt ihrer politischen und kulturellen Entwicklung war: dem so genannten perikleischen Zeitalter, benannt nach dem Politiker Perikles (um 490 v. Chr. bis 429 v. Chr.).
Athen dominierte und beherrschte ungefähr ein Drittel der griechischen Stadtstaaten, teilweise mit brachialer Gewalt. Die Stadt war reich, was für die monumentalen Bauwerke auf der Akropolis eine ziemlich große Rolle spielte. Und in Athen blühten die Philosophie und die Literatur: das perikleische Zeitalter ist auch das Zeitalter der großen attischen Tragödiendichter und des Philosophen Sokrates. Geht man etwas über das Todesjahr von Perikles hinaus, dann fallen auch der Komödiendichter Aristophanes und die Philosophen Platon und Aristoteles etwa in diese Phase.

Athen und seine radikale Demokratie?
In dieser Zeit kann man in Athen tatsächlich von einer Form von Demokratie sprechen, auch wenn wir heute das politische System dieser Zeit nicht mehr sonderlich demokratisch finden würden: Frauen, Sklav*innen und Fremde waren von Wahlen und politischen Ämtern ausgeschlossen.
Aber zu seiner Zeit war das System trotzdem einzigartig: dass das Volk (in dem Fall also erwachsene Männer mit vollem Bürgerrecht) Entscheidungen traf, das war außergewöhnlich. Doch dieses System trug gleichzeitig auch schon den Keim für Athens Niedergang in sich. Das, was wir in Athen in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts finden, ist aus heutiger Sicht in einigen Dimensionen nämlich eine recht radikale Form von Demokratie.
Zum einen handelte es sich um eine direkte Demokratie: Entscheidungen wurden in Volksversammlungen getroffen. Es gab zwar Gremien, die Gesetze vor-berieten und Entscheidungsempfehlungen gaben, aber die Entscheidung lag dann bei der Versammlung erwachsener Männer mit vollem Bürgerrecht.

Foto: Tomisti (CC-BY SA 4.0)
Politische Ämter, vor allem Richterposten, wurden teilweise verlost. Das ist nun wirklich ein sehr besonderes Vorgehen, denn um radikale Fairness zu gewährleisten, spielten persönliche Qualifikationen keine Rolle.
Man stelle sich das einmal heute vor. Dass man in Deutschland mit seinen über 80 Millionen Einwohner*innen an technische und organisatorische Grenzen stoßen würde, wenn man wirklich das Volk alles entscheiden ließe, das lassen wir mal kurz beiseite. Stellen wir uns mal kurz vor, das ginge irgendwie. Vielleicht mit einer App oder so.
Man kann sich schon ausmalen, wo die Probleme lägen: Fühlt sich wirklich jede*r von uns in der Lage, ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Tansania zu bewerten? Oder sich eine Meinung über die Erhöhung von Freibeträgen für Solo-Selbständige zu bilden?
Viele würden da abwinken. Nee, lass mal stecken. Ich verstehe schon die Begriffe gar nicht. Was ist ein Doppelbesteuerungsabkommen überhaupt? Und wer bitte sind immer diese Solo-Selbständigen, von denen alle reden?
Nimmt man Fragen von Krieg und Frieden, oder brisante Themen wie Migration oder das Bürgergeld dazu, ahnt man auch direkt eine zweite Gefahr: dass populistische Parteien oder Gruppierungen ein Thema für sich besetzen und mit Halb- und Unwahrheiten vermeintlich einfache Lösungen präsentieren, die am Ende gewaltigen Schaden anrichten können.
Die Demagogen kommen
Und genau das Problem hatte auch Athen. Zugegeben, politische Entscheidungen waren in der Antike deutlich überschaubarer als heute. Aber auch schon damals gab es Probleme, die man etwas genauer durchdringen musste, um zu einer begründeten Meinung zu gelangen.
Athen befand sich mit Unterbrechungen zwischen 431 und 404 v. Chr. im Krieg mit der Rivalin Sparta. Dabei handelte es sich um einen klassischen Kampf um die Vorherrschaft in Griechenland. Athen hatte sein Bündnissystem, Sparta hatte seins.

Foto: Grant Mitchell, CC BY-SA 2.0)
Dass Athen diesen Kampf am Ende verlor, hat entscheidend mit seinem politischen System zu tun, denn in der Endphase des Krieges überschätzten die Athener gewaltig ihre militärische Kraft, was zu mehreren Fehlentscheidungen führte. Einige Politiker sprachen den athenischen Stolz an, versprachen einen großartigen Sieg und ein goldenes Zeitalter für Athen. Das verfing, endete aber in einem Desaster.
Für diese Politiker wurde ein eigener Begriff geprägt: Demagogen, den wir heute auch noch kennen: „Volksführer“, wobei der Begriff schon in der Antike den Beigeschmack von „Verführer“ hatte. Denn diesen Demagogen ging es vor allem um ihren eigenen Vorteil und ihre eigene politische Macht und Karriere. Und natürlich Geld. „Follow the Money“ funktioniert auch heute als Motto ja immer noch gut, wenn man fragwürdige politische Prozesse hinterfragen will.1
Athen hat also nicht nur die Demokratie entdeckt, sondern auch gleich mögliche Probleme durchlebt. Komplexe politische Entscheidungen sind halt immer so ne Sache. Und welche politischen Entscheidungen sind eigentlich nicht komplex?
Eine Niederlage, die keine Niederlage ist
Aber zurück zur Geschichte Athens. Der Peloponnesische Krieg gegen Sparta endete 404 v. Chr. mit einer Niederlage. Das bedeutete erstaunlicherweise aber kein Ende Athens, was seine kulturelle Bedeutung angeht. Ganz im Gegenteil. Die Stadt blieb noch für Jahrzehnte ein kulturelles Zentrum für bedeutende Dichter und Denker, wie zum Beispiel Platon und Aristoteles.
Auch die Sprache prägte den griechischen Kulturraum. Das ist ein Aspekt, der normalerweise selten erwähnt wird, weil er nur für Leute nachvollziehbar ist, die mal Griechisch gelernt haben. Die griechische Sprache gab es nämlich in der Antike lange Zeit nicht, sondern eine Vielzahl an regionalen Dialekten, die sich teilweise sehr deutlich voneinander unterschieden.
Der attische Dialekt (benannt nach Attika, dem Umland rund um Athen) wurde jedoch im 5. Jahrhundert das entscheidende Vorbild. Im 4. Jahrhundert setze sich dann allmählich so etwas wie eine griechische „Allgemeinsprache“ durch, die sogenannte Koiné. Die fußte aber auch wesentlich auf dem attischen Griechisch, auch wenn man beides nicht gleichsetzen kann.
Athen im Hellenismus
Dass sich eine solche Gemeinsprache durchsetzte, hatte mit Vorgängen im 4. Jahrhundert zu tun, bei denen die Stadt Athen fast nur noch Zuschauerin war: Ein gewisser Philipp II., König von Makedonien, weitete schrittweise seine Macht im griechischen Raum aus.
Ein berühmter Athener verdankte diesem Umstand seine Nachwirkung: der Redner Demosthenes. In seinen so genannte „Philippischen Reden“ wetterte er gegen Philipp und die Ausweitung seiner Macht. Übrigens gibt es den Ausdruck „philippische Reden halten“ auch heute noch im Deutschen, wenn man eine Brand- oder Kampfrede hält. Und der römische Politiker Cicero borgte sich den Titel Jahrhunderte später, als er gegen Marcus Antonius wetterte.

Geholfen haben Demosthenes’ Tiraden aber nicht. Außer in der Hinsicht, dass seine Reden später stilbildend für das klassische Griechisch wurden und dass man damit heute noch gerne Griechisch-Student*innen quält.
Philipps Sohn setzte sein Werk fort, und diesen Sohn kennen auch wirklich alle: Alexander der Große. Ihm gelang es nicht nur, ganz Griechenland unter seine Kontrolle zu bringen, sondern auch ein Weltreich zu erobern. Gut, das hatte dann nicht sehr lange Bestand und zerfiel nach seinem Tod im Jahr 323 v. Chr. in mehrere Teilreiche.
Aber er (und seine Nachfolger) etablierten die griechische Kultur und Sprache in einem weiträumigen geografischen Raum. Der reichte von Griechenland bis zum Hindukusch in Afghanistan, und vom Schwarzen Meer bis nach Ägypten.
Das, was sie dabei etablierten, war eine griechische Kultur und eine griechische Sprache, die maßgeblich von der attischen Kultur und Sprache beeinflusst war. Dass wir also heute Athen und Griechenland gedanklich oft gleichsetzen, kommt nicht von ungefähr. Das war schon in der Antike so. Athen spielte politisch aber zu dieser Zeit keine große Rolle mehr.
Neue kulturelle Zentren
Athen erhielt auch im kulturellen Bereich Konkurrenz. Vor allem Alexandria in Ägypten sollte man da wohl erwähnen, mit seiner gewaltigen Bibliothek. Die Stadt entwickelte sich zu einem neuen kulturellen Zentrum, das Athen den Rang ablief.

Auch andere Städte wie Pergamon entwickelten eine Sogkraft für Wissenschaftler, Philosophen und Literaten. Und einen geografischen Bereich sollte man auch erwähnen: Sizilien und Süditalien. Auch dort gab es zahlreiche griechische Städte, und auch dort gab es bedeutende Denker der Antike, allen voran natürlich Archimedes, der im 3. Jahrhundert vor Christus lebte.
Zu seiner Zeit war Athen längst schon wieder eine Stadt unter vielen. Sicher eine, die sich noch im Glanz ihrer Vergangenheit sonnen konnte und auf die man mit einer gewissen Bewunderung und Respekt blickte. Aber wirklich bedeutend war die Stadt überhaupt nicht mehr.
Die großen philosophischen, literarischen und sonstigen kulturellen Strömungen entwickelten sich ganz woanders. Und die großen politischen Entscheidungen wurden auch längst woanders getroffen, nämlich von Königen an ihren Höfen.
Was ist Adel?
Solche monarchischen oder aristokratischen Strukturen waren Athen aus seiner Geschichte natürlich nicht unbekannt. Auch in der Zeit, in der sich die attische Demokratie entwickelte, gab es immer wieder Rückschläge, wie die Alleinherrschaft des Peisistratos (ca. 600 bis 528/527 v. Chr.). Zudem gab es in Athen auch immer politische Strömungen, die die Demokratie ablehnten.
Wenn wir auf die Zeit vor der Demokratie schauen, kommen wir in den Bereich der Frühgeschichte Athens, und da ist Vieles nicht so ganz gesichert. Eins kann man aber relativ sicher sagen: Athen wurde in seiner Frühzeit wohl nicht von Königen beherrscht. Beziehungsweise: Man müsste vielleicht da erst mal definieren, was „König“ eigentlich genau heißt.
Wir würden uns darunter heute einen Mann vorstellen, der die absolute (oder zumindest fast absolute) Macht im Staat hat. Und: Er vererbt oft seine Krone direkt oder indirekt an ein Familienmitglied. Es entwickelt sich also so eine Art Dynastie.
Für die Legitimation eines Königs spielt also seine Abstammung eine große Rolle. Man denke da mal kurz an das britische Königshaus mit seinen absurd komplizierten Thronfolgelisten, die manchmal durch die Presse gehen. Da steht dann Prinz Harry auf Platz XY der Thronfolge, denn vorher kommt noch der Earl of Middlethrithm und die Countess of Uddlepuddleborough oder so was. Keine Ahnung.
Abstammung ist nicht alles
Das ist aber ein mittelalterlich-neuzeitliches Ding und muss alles nicht zwangsläufig in anderen Kulturen und Zeiten so sein. Athen ist dafür ein gutes Beispiel. Es gab in Athen über Jahrhunderte einen Adel. Der definierte sich aber primär über Vermögen, nicht über die Abstammung. Beides hängt natürlich miteinander zusammen: Sind die Eltern reich, sind es die Kinder in der Regel dann auch.
Trotzdem konnte sich in dieser frühen Adelsgesellschaft keiner einfach auf seiner Abstammung ausruhen. Das Vermögen musste gesichert werden. Und politischer Einfluss fiel auch nicht einfach vom Himmel. Es gab einen beständigen Wettkampf zwischen Adligen im Stadtstaat. Leistungen spielten da eine Rolle, natürlich militärische, aber auch für die Gemeinschaft.
Dieses System können wir ziemlich gesichert übrigens für die meisten griechischen Stadtstaaten im 8. bis 6.. Jahrhundert vor Christus nachweisen. Da ist Athen keine Ausnahme. Man kann also nicht von einer Königsherrschaft sprechen, sondern von einer Adelsherrschaft. Heute würden wir so was als Oligarchie bezeichnen.
Geht man noch etwas weiter in der Geschichte zurück, dann finden wir aber durchaus auch den Begriff „König“. Nicht direkt im Zusammenhang mit Athen, denn dafür war die Stadt noch viel zu unbedeutend. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass es dieses System von „Königen“ in ganz Griechenland gab.
Könige in Athen?
Die Quellenlage ist dafür noch schlechter als für das System der Adelsherrschaft im 8. bis 7. Jahrhundert. Denn eigentlich haben wir dafür nur eine Quelle: Homer. Inwiefern sich ein hochliterarischer Text als Quelle eignet, darüber kann man streiten, und darüber wurde und wird auch immer wieder heftig gestritten.
Jedenfalls handelte es sich bei diesen „Königen“ in der frühen griechischen Literatur um Lokalherrscher. Odysseus ist dafür ein bekanntes Beispiel. Der beherrschte Ithaka und so, wie es bei Homer dargestellt wird, war er wirklich die umfassende Queen of fucking everything auf der Insel.
Man kann annehmen, dass es auch im Gebiet Attika rund um die Stadt Athen in der Frühzeit so etwas wie Könige gegeben hat. Später entwickelte sich ein oligarchisches System von Adligen, das wir etwas besser fassen können und bei dem Macht und politischer Einfluss auf Vermögen und Leistung beruhten.
Die große Krise des Systems
Dieses System geriet Ende des 7. Jahrhunderts in eine Krise, übrigens in vielen griechischen Stadtstaaten. Im Fall von Athen können wir die Gründe dafür gut analysieren, weil uns etliche Quellen zur Verfügung stehen: vor allem Überschuldung und Verarmung weiter Teile der Bevölkerung waren dafür verantwortlich.
Diese Krise führte in allen möglichen griechischen Stadtstaaten zu Veränderungen. In Athen war die Antwort darauf die Entwicklung eines demokratischen Systems. Das ging aber auch nicht auf einen Schlag, sondern zog sich über Jahrzehnte hin.
Solon bewirkte erste Reformen, nach ihm setzte Kleisthenes weitere Veränderungen durch. Und schließlich sorgte Perikles vor allem dafür, die politische Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten abzusichern.

Und damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt, dem perikleischen Zeitalter und der Blüte Athens in politischer, militärischer sowie kultureller und literarischer Hinsicht.
Athens Bedeutung
Die wechselhafte Geschichte Athens spiegelt in vielen Bereichen also die Geschichte vieler griechischer Stadtstaaten wider. Darüber darf man aber nicht vergessen, dass es durchaus auch deutliche Unterschiede gab, denn zum Beispiel eine Demokratie entwickelte sich längst nicht überall.
Oft wird heute ja verallgemeinernd gesagt: Die Demokratie stammt aus Griechenland. Darüber hätten sich die Menschen in der griechischen Antike vermutlich ziemlich aufgeregt. Und auch wenn wir über kulturelle Phänomene sprechen, dann findet sich diese Vereinfachung. Wir sprechen über griechische Tragödien und meinen eigentlich damit die Tragödien von nur drei Autoren aus Athen im 5. Jahrhundert.
Zumindest bei der „griechischen Philosophie“ können wir ruhigen Gewissens bei diesem Ausdruck bleiben, denn längst nicht alle Philosophen stammten tatsächlich aus Athen. Aber viele von ihnen zog es irgendwann dorthin, um zu lehren und selbst zu lernen.
Athen hat die griechische Kultur und Geschichte stark geprägt. Insofern ist es kein Wunder und vielleicht auch letztlich gar nicht mal so schlimm, dass wir an manchen Punkten heute verallgemeinern.
Viele Fachleute würden an der Stelle jetzt bedauern, dass wir über andere griechische Stadtstaaten, ihre Entwicklung und ihre Kultur deutlich weniger wissen. Die griechische Welt war in der Antike ziemlich vielfältig.
Das ist sicher richtig, aber damit müssen wir wohl leben. Aber immerhin: Die Geschichte Athens in der Antike ist für sich allein genommen schon vielseitig und spannend genug.
- Der Spruch stammt aus einem amerikanischen Dokudrama aus dem Jahr 1976 („All President’s Men“) über den Watergate-Skandal. Hinter dem Spruch steht die Annahme, dass man Korruption und ungesetzliches Verhalten einflussreicher Personen am einfachsten dadurch enttarnen, kann, dass man Geldflüsse untersucht. Und wenn man mal so darüber nachdenkt: Da ist sicher eine ganze Menge dran. ↩
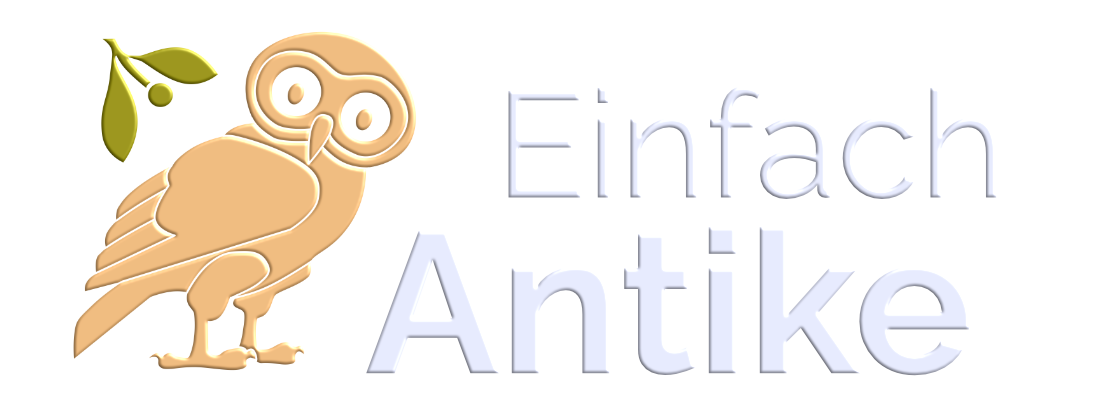
Schreibe einen Kommentar