Wir alle kennen das: Der Partner lässt zum wiederholten Mal seine Kleidungsstücke auf dem Fußboden rumliegen, obwohl man schon fünfmal darum gebeten hat, sie in den Wäschekorb zu schmeißen. Will der mich jetzt provozieren? Supermärkte sind auch ein perfekter Ort, um Provokationen zu beobachten.
Da hätten wir Gabi, die ihren Einkaufswagen quer im Gang stehen lässt. Oder Rainer, der das Brotregal blockiert, weil er erst mal in Ruhe alle Inhaltsstoffe studieren will. Und natürlich der Klassiker: Agathe, die an der Kasse in 1-Cent-Münzen bezahlt, während die Schlange immer länger wird. Sind die alle doof oder wollen die uns provozieren?
Um erst mal Letzteres zu beantworten: Ja, die sind alle doof. Zu dieser Erkenntnis bin ich nach jahrzehntelangen Feldstudien in Supermärkten gekommen. Menschen beim Einkaufen sind wirklich eine andere Spezies. Kaum jemand von denen will wirklich provozieren, aber viele schalten aus unerfindlichen Gründen ihr Gehirn aus, sobald sie ihren Einkaufswagen durch die Tür schieben.
Aber auch wenn es keine Absicht ist, macht das etwas mit uns: Wir fühlen uns provoziert. Das ist diese unangenehme Gefühl, wenn die Wut langsam aus dem Bauch nach oben steigt und den Weg zum Mund sucht, weil man diese freche Person zusammenstauchen will.
Wenn es ganz schlimm läuft, dann versucht die Wut auch einen Weg in andere Körperteile zu finden. Ein Schlag oder Tritt, auch das liegt manchmal im Bereich des Möglichen, wenn man sich provoziert fühlt.
Übrigens provozieren uns nicht nur Menschen. Auch Tiere oder Gegenstände können das. Wer hat noch nie gegen ein Möbelstück getreten, an dem man sich den Fuß angestoßen hat? Oder hätte gerne seinen Computer aus dem Fenster geworfen, weil der Druckbefehl wieder mal nicht ausgeführt wurde.
Man kann sich auch von Unternehmen oder Produkte provoziert fühlen. Facebook zum Beispiel für seine schrottige Plattform. Oder Microsoft, wenn sich bei Word wieder alle Textblöcke verschoben haben, nur weil man ein Bild einfügen wollte.
Aber genug davon. Beispiele für Provokationen oder das Gefühl, provoziert zu werden, kennt man genug. Wichtig ist, dass bei den allermeisten von uns dann aber doch die Regulationsmechanismen greifen und wir eben weder verbal noch körperlich gewalttätig werden.
Aber was genau bedeutet eigentlich der Begriff „Provokation“. Gemeint ist damit ein Verhalten (oder eine Eigenheit), die Wut erzeugt. Dahinter steckt das lateinische Verb provocare. Es bedeutet wörtlich erst mal „herausrufen“ oder „hervorrufen“.
Im übertragenen Sinn sind damit im klassischen Latein dann aber auch Herausforderungen gemeint. Das kann zum Beispiel auf ein Spiel bezogen sein. In einer Komödie des Dichters Plautus sagt eine Figur zum Beispiel: Provocat me in aleam. – Er forderte mich zu einem Würfelspiel heraus. An einer anderen Stelle ist auch die Rede von einem Wettlauf, zu dem man provoziert wird.
Übrigens kann das Wort im Lateinischen auch positiv gemeint sein. An einigen Stellen ist zum Beispiel die Rede, dass man jemanden zu einer guten Tat provoziert. Wir würden da wohl „anregen“ oder „ermuntern“ sagen.
Und schließlich hat das Wörtchen auch noch eine juristische Bedeutung, nämlich so viel wie „ein Urteil anfechten“ oder „in Revision gehen“. Man lässt sich also von einem Urteil zu einer Reaktion bringen.
Wenn man das zusammenfassen will, dann bedeutet provocare also immer so viel wie „anregen zu etwas“ oder „herausfordern“, aber nie in dem Sinn, wie wir es heute verwenden. Zum einen ist für uns heute „provozieren“ immer etwas Negatives. Und es ist auch immer mit Zorn oder Wut verbunden.
Wenn man an das Beispiel aus der Plautus-Komödie denkt: Gut, Spiele können schon provozierend wirken. Manche Leute neigen ja dazu, das Monopoly-Brett durch das Zimmer zu werfen, wenn sie wieder auf die Schlossallee kommen. Aber normalerweise sind Spiele doch wohl eher eine friedliche Art der Provokation.
Kannten die Alten Römer also das Phänomen der Provokation, wie wir es heute kennen, gar nicht? Waren die so friedlich, dass sie Agathe mit ihrem Scheiß Kleingeld an der Kasse einfach zu einem Würfelspiel herausgefordert hätten, um ihrem Ärger Luft zu machen?
Natürlich nicht. Wut und Zorn, vor allem über die nervige Personen, liegen wohl in der Natur des Menschen. Die alten Römer hätten dafür nur andere Begriffe benutzt. Lacessere zum Beispiel: „reizen“.
Oder auch sehr schön: irritare. Das kennen wir heute auch noch als „irritieren“. Aber dieses Wort hat im Lateinischen sehr viel häufiger als heute die Bedeutung „zur Wut reizen“. Kein Wunder, denn darin steckt ja auch das lateinische Wort ira für Zorn.
Das Lateinische kannte also sehr wohl Ausdrücke für das Phänomen, dass uns manche Menschen oder Gegenstände zur Weißglut treiben. Sie haben sich auf dem Weg in die deutsche Sprache nur etwas in der Bedeutung verschoben.
Aber das sollte uns nicht in irgend einer Form irritieren oder sogar provozieren. Ärgern macht eh hässlich. Manchmal hilft es auch, sich diesen Gedanken klarzumachen, einmal tief durchzuatmen und sein Ding zu machen. Gerade im Supermarkt.
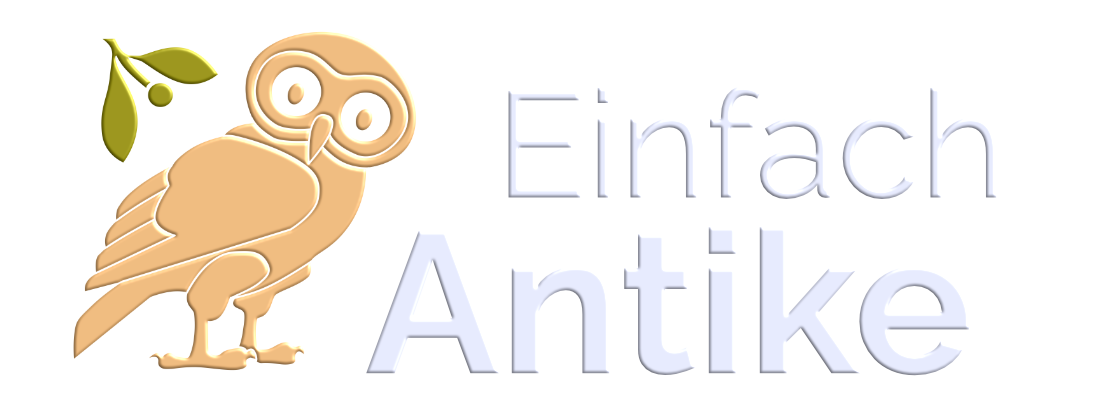
Schreibe einen Kommentar