„…wirst du ein großes Reich zerstören.“ Auf diesen Orakelspruch verließ sich um 640 v. Chr. der lydische König und blies zum Angriff auf das Perserreich. Das Unternehmen endete im Desaster. Und an seinem Anfang steht ein gründlich missverstandener Orakelspruch.
Dem lydischen König gelangen zu Beginn noch einige Erfolge, nachdem er den Grenzfluss Halys, der heute im Norden der Türkei liegt, überschritt. Aber das Glück wendete sich. Er zog sich nach einer großen Schlacht gegen die Truppen des persischen Großkönigs zurück und wurde in seiner Hauptstadt Sardeis belagert, bis er aufgeben musste.
Aber fangen wir vorne an. Erst mal sortieren. Das Königreich Lydien lag zur damaligen Zeit in der heutigen westlichen Türkei. Der König, über den wir hier reden, trug übrigens einen Namen, den heute auch noch die meisten von uns kennen: Krösus.
Wer waren die Lyder?
Der Name steht heute vor allem für Reichtum, und das war schon in der Antike so. Die lydischen Könige und auch das lydische Reich galten als wohlhabend. Dazu passt, dass die Erfindung des Münzgeldes in Lydien stattfand. Es kam dort erstmals im 6. Jahrhundert vor Christus auf.
Das Volk der Lyder siedelte ursprünglich in einem vergleichsweise kleinen Gebiet in Westanatolien, das von der Forschung heute nicht so ganz genau lokalisiert werden kann. Etwa ab der Mitte des 7. Jahrhunderts wird für uns eine Dynastie von Königen historisch fassbar, an deren Ende Krösus steht, um den es hier heute geht.

Foto: A. Davey (CC BY-SA 2.0)
Den lydischen Königen gelang es, ein beachtliches Reich aufzubauen und zu erobern, das zur Zeit der Herrschaft des Krösus praktisch den ganzen Westen Anatoliens umfasste. Auch ihm selbst gelang es, einige Gebiete hinzuzufügen. Doch am Horizont zeichnete sich ein Gegner ab, mit dem er es nicht so leicht haben würde: die Perser.
Perser? Meder? Achaemeniden?
„Die Perser“ ist ein schwieriger Begriff. Wir benutzen ihn heute immer noch, weil wir ihn sofort mit ein paar historischen Ereignissen in Verbindung bringen können, die viele von uns kennen: die Perserkriege und die Eroberungszüge Alexanders des Großen.
Man muss aber etwas genauer hinschauen. „Perser“ ist eine Bezeichnung für ein Volk, das in der Antike im heutigen Iran siedelte. Das so genannte „Perserreich“ war aber eigentlich gar kein Reich „der Perser“.
Ich will es hier nicht zu kompliziert machen, aber man kann es ganz gut eindampfen: Im Gebiet des heutigen Iran entwickelte sich im 8. Jahrhundert das Reich der Meder. Die Meder waren ebenfalls ein Volk, das dort siedelte. Sie brachten zahlreiche andere Völker und Gebiete unter ihre Kontrolle.
Allerdings spricht die Forschung heute nicht mehr von einem Reich, sondern eher von einer Art „Konföderation“. Entgegen der früheren Sichtweise herrschten die medischen Könige nicht über ein Reich, sondern standen einer Vielzahl von Verbündeten vor.
Um 550 v. Chr. endete die Dynastie der medischen Könige. Ein persischer König (Kyros II.) übernahm die Vorherrschaft. Von da an spricht man von einem persischen Reich. Das Problem dabei: Der Wechsel an der Spitze war eigentlich nur der Wechsel von einer Dynastie zu einer anderen. Für die Menschen der Region änderte sich so gut wie nichts.

Hinzu kommt noch: Medische Adlige waren selbst an dem Umsturz beteiligt, und viele von ihnen blieben danach in Rang und Ehren. In der Forschung tut man sich daher heute schwer, von einem „medischen Reich“ und einem „persischen Reich“ zu sprechen. Passender wäre der Gegensatz „medische Konföderation“ und „Reich der Achaemeniden“, denn „Achaemeniden“ ist der Name der neuen „persischen“ Dynastie, die da an die Macht kam.
Krösus hat Probleme mit dem Ganzen
Krösus sah sich also damit konfrontiert, dass es in seinem Nachbarreich gerade zu einem Umsturz gekommen war. Kyros II. hatte den Thron bestiegen und die Herrschaft über die ehemalige medische Konföderation übernommen.
Und das war für Krösus aus mehreren Gründen ein Problem. Da wäre zum einen die Unsicherheit: Wie wird sich dieses riesige Reich nach dem Wechsel an der Spitze verhalten? Könnte es zu einer Bedrohung werden? Könnte das vielleicht aber auch eine Chance sein, sich weitere Teile Anatoliens unter den Nagel zu reißen?
Und dann gab es da noch eine Sache: Der zuletzt abgesetzte medische König war ein Schwager des Krösus. Überhaupt kann man sich die Verwandtschafts- und Verschwägerungsverhältnisse im Nahen Osten zu dieser Zeit etwa so vorstellen wie im europäischen Adel der Neuzeit.
Möglich wäre es also auch, dass Krösus auch einen Rachegedanken hatte, als er sich gegen das Perserreich wendete.
Ein doppeldeutiger Orakelspruch
Das könnten also die Motive sein, weswegen Krösus den Beschluss fasste, gegen das alte Reich mit neuer Herrschaft zu Felde zu ziehen. Und hier kommt jetzt unser Orakelspruch zum Zug. Wie man es in der Antike so machte, wurde nämlich erst mal der göttliche Wille befragt, bevor man so was Waghalsiges wie einen großen Kriegszug unternahm.
Krösus schickte Boten nach Delphi, und das dortige Orakel antwortete: „Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.“ Der Halys ist der damalige Grenzfluss zwischen dem lydischen und dem persischen Reich. Den gibt es auch heute noch, falls jemand von euch mal hinfahren will.
Übrigens ist der Spruch aus der antiken Literatur so direkt gar nicht überliefert. Er wird nur indirekt zitiert, nämlich bei Herodot1 und bei Diodor2.

Das Orakel sagt nur aus, dass Krösus ein Reich zerstören werde. Welches, das bleibt unklar. Darin besteht der Witz in dieser ganzen Geschichte. Dass Orakel in der Antike maximal unklar und doppeldeutig blieben, ist nichts Ungewöhnliches. Nirgendwo hat der Satz „Die Botschaft entsteht beim Empfänger“ wohl mehr Sinn als bei Orakelsprüchen.
In diesem Fall ist auch ziemlich leicht nachvollziehbar, was da passiert ist: Krösus ist so von der Idee eingenommen, das Reich der Achaemeniden anzugreifen, dass er den Orakelspruch automatisch in seinem Sinne interpretiert.
Krösus und der Confirmation Bias
Heute hätten wir eine ganze Latte von Fachbegriffen oder Pseudo-Fachbegriffen, um das zu beschreiben. Da hätten wir erst mal die „Ambiguitätsverzerrung“. Wir neigen dazu, mehrdeutige Botschaften eindeutig zu machen. Krösus versteift sich also auf eine der möglichen Varianten.
Dann hätten wir den „Confirmation Bias“: Wir neigen dazu, Informationen so zu deuten, dass sie unsere Erwartungen bestätigen. Krösus hat vielleicht einen positiven Orakelspruch erwartet. In Kombination mit der Ambiguitätsverzerrung wäre damit klar, warum er diese Variante wählte.
Es geht aber noch weiter, denn es gibt ja noch die „selbstwertdienliche Verzerrung“ aka „Self-serving Bias“. Wir deuten Informationen auch gerne schon mal so, dass sie unser eigenes Selbstbild stärken. In Krösus Fall: Natürlich ist er der starke König, der ein fremdes Reich unterwirft. Was anderes passt gar nicht in sein Weltbild.
Vielleicht ist diese Analyse aber auch ein bisschen drüber, und man kann einfach das nehmen, was meine Oma gesagt hätte: Es war einfach reines Wunschdenken.
Gab es den Spruch denn wirklich?
Kann man den Spruch als Legende abtun, oder gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass er tatsächlich gegeben wurde? Die klare Antwort lautet: Jein.
Es spricht erst mal nicht wirklich was dagegen, die Geschichte für bare Münze zu nehmen. Wir wissen, dass Orakel vor wichtigen Unternehmungen, vor allem Kriegszügen, in der Antike konsultiert wurden. Wir wissen auch, dass solche Orakel in der Regel zwei- oder mehrdeutig waren.
Andererseits ist die antike Geschichtsschreibung voll von Legenden und Anekdoten, gerade bei Herodot, der uns die ganze Geschichte von Krösus ausführlich erzählt. Die Tatsache, dass zwei antiken Autoren (nämlich auch Diodor) davon berichten, hat an der Stelle keine Relevanz. Diodor lebte viele Jahrhunderte später (im 1. Jhd. v. Chr.). Er hat die Geschichte vielleicht schlicht und ergreifend selbst bei Herodot gelesen.
Wie überquert man einen Fluss?
Für alle, die jetzt schon hibbelig werden und wissen wollen, was aber denn nun genau passiert ist, nachdem Krösus den Halys überschritt, kommt hier jetzt das Ende der Geschichte. Angeblich ließ Krösus den Fluss Halys umleiten, um ihn überqueren zu können. Oder anders formuliert: Er überquerte nicht den Halys, sondern der Halys überquerte ihn.
Er schlug ein Heerlager am Halys auf, und anstatt seine Truppen über den Fluss zu bringen, riet ihm der Mathematiker Thales, einen Graben auszuheben und den Fluss hinten um das Feldlager des Krösus herumzuleiten. Er sorgte also dafür, dass der Fluss nicht mehr vor ihm lag, sondern hinter ihm vorbeifloss.
Coole Geschichte, aber die ist ziemlich sicher nicht wahr. Das merkt auch schon Herodot an, der sie überliefert.3 Und wenn Herodot bei einer Geschichte schon selbst sagt, dass sie unglaubwürdig ist, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen.
Wahrscheinlicher ist, dass Krösus Behelfsbrücken bauen ließ, wie man das halt so macht, wenn man mit einem Heer einen Fluss überqueren muss.
Erste Erfolge
Krösus gelang es, einige militärische Erfolge zu erringen, bis der persische Großkönig Kyros II. ein Heer mobilisiert hatte, um sich dem Eindringling entgegenzustellen. Bei der Stadt Pteria kam es zur Schlacht, aber es gab keinen klaren Gewinner.
Und an dieser Stelle leistete sich Krösus eine dramatische Fehleinschätzung. Er zog sich nämlich zurück. Nicht, weil er sich besiegt fühlte, sondern weil er glaubte, die Zeit für Kriegszüge sei für dieses Jahr vorbei. Militärische Unternehmungen fanden in der Regel in der Antike nämlich nur im Frühjahr und Sommer statt.
Er zog sich in seine Hauptstadt Sardeis zurück und entließ sogar einen Großteil seiner Truppen. Er wollte für das nächste Jahr ein neues Heer zusammenstellen, um den Kampf fortzusetzen. Er hatte aber wohl nicht mit dem militärischen Einfallsreichtum des persischen Königs gerechnet.
Der schickte sein Heer in einem Gewaltmarsch hinterher. Krösus versuchte, seinen Verfolger zu stoppen, indem er ihnen Kavallerieverbände entgegenschickte.
Laut Herodot war Kyros aber schlau. Er entsandte Kamelreiter. Und weil Pferde angeblich den Geruch von Kamelen abstoßend finden, konnte die lydische Kavallerie geschlagen werden. Kyros und seine Truppen stießen bis Sardeis vor und belagerten die Stadt.4
Die Belagerung von Sardeis
Kyros kam bei der Belagerung von Sardeis schließlich der Zufall zur Hilfe. Ein lydischer Soldat, der auf den Zinnen der Stadtmauer Wache hielt, verlor seinen Helm. Er kletterte an einer Stelle den Felsen hinunter, um ihn zurückzuholen.
Da ein Marder den Vorgang beobachtet hatten, kannten sie nun die Schwachstelle der Verteidigung. Übrigens: Nein, ich spreche hier nicht vom Tier „Marder“. So verrückt ist die Geschichte dann auch wieder nicht. Die Marder waren eine Volksgruppe, von denen einige unter dem Kommando des Kyros mitkämpften.
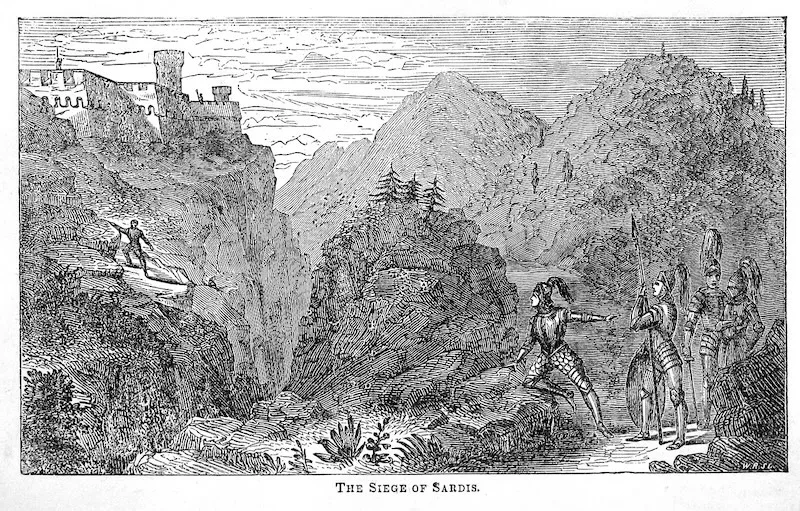
Es gab also eine Stelle, an der man die Felsen erklimmen und in die Stadt eindringen konnte. Auch diese Geschichte stammt von Herodot, und man muss sie mit Vorsicht genießen.5
Sie klingt aber zumindest etwas plausibler als die Geschichte, die Xenophon berichtet.6 Ihm zufolge hatte Kyros den Sohn des Krösus als Geisel genommen und tötete ihn nun gut sichtbar vor den Stadtmauern. Daraufhin habe sich seine Mutter (also Krösus’ Frau) weinend von der Stadtmauer gestürzt.
Anschließend bastelten die Perser Holzpuppen, die Krösus Frau und den Sohn darstellten, und hielten sie an langen Stangen über die Stadtmauer. Das habe Panik unter den Eingeschlossenen bewirkt, sodass sie sich ergaben.
Entweder waren antike Kriege manchmal auch sehr lustig, oder das alles ist ziemlicher Quatsch. Das zu entscheiden, überlasse ich jetzt einfach euch.
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?
Was aus Krösus wurde, ist unklar und umstritten. Eusebius von Caesarea berichtet, er sei einfach getötet worden.7 Das wäre jetzt nicht wirklich überraschend.
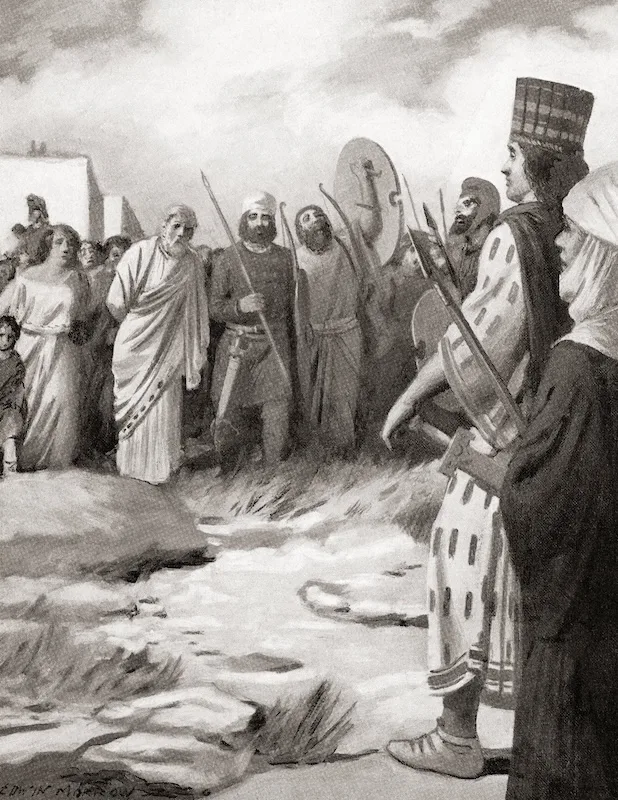
Aber andere antike Geschichtsschreiber, unter ihnen Xenophon und Herodot sowie der Dichter Bacchylides berichten dagegen, Krösus sei zu einem Vertrauten oder sogar zu einem engen Freund des persischen Königs geworden. Wann und wie er starb, ist in diesen Varianten völlig unklar.
Dass Krösus zu einem Vertrauten des Großkönigs wurde, könnte durchaus möglich sein. Gute Verbindungen zur lokalen Elite konnten schon zu allen Zeiten dazu beitragen, eine Herrschaft zu stabilisieren. Und genau das geschah auch: Das lydische Reich ging im Reich der Achaemeniden auf.
Übrigens ist das auch der Grund, warum uns der griechische Geschichtsschreiber Herodot so viel über die Ereignisse in Lydien und rund um König Krösus erzählt. Das Ganze nimmt den größten Teil des ersten Buchs seiner Historien ein.
Mit der Einnahme von Sardeis und den lydischen Reiches rückten die Achaemeniden an den Einflussbereich der griechischen Stadtstaaten heran. Einige davon, nämlich die an der kleinasiatischen Küste, befanden sich ab jetzt sogar unter der Vorherrschaft der Perser.
Aber das ist noch mal eine ganz eigene Geschichte.
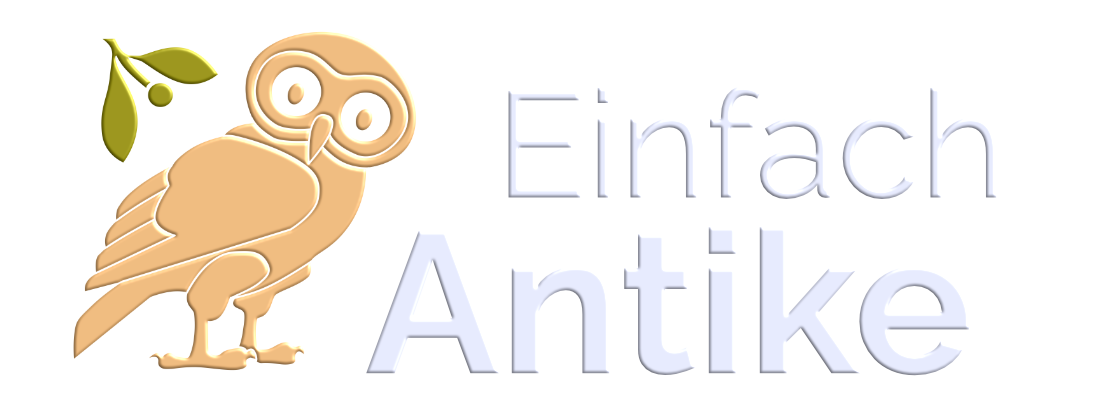
Schreibe einen Kommentar