Bei der Schizophrenie (externer Link) handelt es sich genau genommen um eine Gruppe psychischer Erkrankungen, die zwar Ähnlichkeiten aufweisen, aber auch sehr unterschiedlich in Erscheinung treten können. Ein sehr häufiges Symptom sind Wahnvorstellungen (wie die berühmten „Stimmen im Kopf“), aber auch Schwierigkeiten beim sozialen Umgang mit anderen Menschen, Antriebslosigkeit und der Verlust motorischer Fähigkeiten.
Die altgriechische Bedeutung des Begriffs
Der Begriff „Schizophrenie“ besteht einmal aus dem altgriechischen Verb „σχίζειν“ (schízein, getrennt gesprochen: s-chizein), was „spalten, trennen“ bedeutet. Soweit kann man den Begriff nachvollziehen, denn schizophrene Menschen leiden oft unter scheinbar gegensätzlichen Symptomen, beispielsweise Wahnvorstellungen auf der einen und Antriebslosigkeit auf der anderen Seite.
Außerdem wirkt ihre Persönlichkeit gelegentlich „gespalten“, als ob man es mit zwei Menschen zu tun hätte. Aber Achtung: Eine so genannte „gespaltene Persönlichkeit“ (fachwissenschaftlich „dissoziative Identitätsstörung“) ist wieder etwas ganz Anderes.
Die zweite Hälfte des Wortes geht auf den Begriff „φρήν“ (phrén) zurück, was „Zwerchfell“ bedeutet. Also hätte man es demnach mit einem gespaltenen Zwerchfell zu tun. Das ist nun erklärungsbedürftig.
Antike Medizin
Die Medizin der Antike steckte, von heute aus betrachtet, in den Kinderschuhen. Schon bei körperlichen Erkrankungen tat man sich schwer. Das ist nachvollziehbar, denn solange man keine Möglichkeit hatte, Bakterien und Viren als Krankheitserreger auszumachen, war man auf andere Theorien angewiesen.
So wurden Infektionskrankheiten beispielsweise als Folge „schlechter Luft“ gedeutet. (Daher hat übrigens die Malaria ihren Namen, lateinisch: malus aër – „schlechte Luft“). Was sollte man auch tun? Das war die beste Erklärung, die man sich zurechtlegen konnte.
Dementsprechend waren auch die medizinischen Therapien der Antike aus unserer Sicht unausgereift. Auch im Bereich der – wie wir heute sagen würden – Anatomie sah es nicht viel besser aus. Schneidet man einen Menschen auf, findet man ein verwirrendes und unüberschaubares Geflecht aus Organen, die irgendwie auf den ersten Blick alle gleich eklig aussehen. Erst durch Versuch und Irrtum musste man herausfinden, welches Organ welche Funktion übernimmt, welche Fehlfunktionen es gibt, welche Schädigungen.
Was das Zwerchfell mit Schizophrenie zu tun hat
Und doch gab es in der Antike erste Versuche, die Medizin systematisch wissenschaftlich zu betreiben. Beim Übergang ins Mittelalter spielte es für die Überlieferung jedoch vor allem ein Rolle, inwiefern die medizinischen Erkenntnisse (und ihr philosophischer Hintergrund) mit dem christlichen Glauben vereinbar waren. Das führte dazu, dass viel medizinisches Wissen verloren ging und in der Neuzeit neuentdeckt werden musste.
Von den medizinischen Ansätzen der Antike war es vor allem die aristotelische „Viersäftelehre“, die bis in die frühe Neuzeit eine zentrale Rolle einnahm. Auch der berühmte Hippokrates wurde immer wieder bemüht. Aus seiner Schule stammte auch die Vorstellung, dass das Zwerchfell der Sitz der Seele sei, auch wenn diese Vorstellung nicht auf ihn selbst zurückgeht, sondern noch älter ist.
Diese Vorstellung hat mit Sicherheit mit der Beobachtung zu tun, dass das Zwerchfell für die Atmung wichtig ist. Die Verbindung zur Seele ist auch für uns nachvollziehbar, denn auch wir sprechen davon, dass jemand beim Tod „sein Leben aushaucht“. Die Seele ist in diesem Vorstellungsbild gleichbedeutend mit dem Atem als Lebenszeichen.
Psychische Erkrankungen in der Antike
Nun stammt der Begriff der Schizophrenie aber gar nicht aus der Antike. Die Menschen dieser Epoche hatten allenfalls eine vage Vorstellung von psychischen Erkrankungen. Depressionen beispielsweise wurden durchaus als eine Erkrankung der Seele betrachtet, wenn man auch die Ursachen nicht verstand.
Wahnvorstellungen dagegen, wie sie im Rahmen der Schizophrenie vorkommen können, wurden als göttliches Wirken interpretiert. Und das übrigens nicht zwangsläufig negativ, denn sie konnten auch ein erwünschtes Phänomen im Rahmen von Kulthandlungen oder der Weissagung werden. Auch wenn wahnhaftes Verhalten negative Auswirkungen für die betroffene Person und ihr Umfeld hatte, handelte es sich nach antikem Verständnis um eine göttliche Inspiration. Und damit diente sie einem höheren Zweck, was auch immer der sein mochte.
Das bedeutet natürlich nicht, dass man wahnhaftes Verhalten in der Antike gut fand. Selbstverständlich löste es auch Unverständnis und Angst aus. Aber es erfüllte die Menschen mit Respekt. Für die Antike waren die Betroffenen keine bemitleidenswerten oder gar verachtenswerten „Irren“, die man wegsperren sollte. Der Gedanke, dass man alles, was man nicht versteht, verstecken oder töten sollte, kam erst in späteren Epochen auf.
Die Entstehung des Begriffs „Schizophrenie“
Jedenfalls kannte die Antike den Begriff „Schizophrenie“ nicht, weil man sich gar nicht dessen bewusst war, es mit einer Krankheit zu tun zu haben.
Geprägt wurde der Ausdruck von dem schweizer Psychiater Eugen Bleuler im Jahr 1908. Er wusste natürlich, dass das Zwerchfell nicht der Sitz der Seele ist. Zu seiner Zeit bedienten sich die Wissenschaft und Forschung aber eben gern in den klassischen Sprachen, wenn sie neue Entdeckungen und Phänomene benennen wollten. Der altgriechische Begriff „φρήν“ (phrén) ist dabei recht naheliegend, auch wenn man die dahinterliegende Vorstellung nicht mehr teilt.
Ob seine Wahl klug war, da sie einen überholten Glauben über Organe und ihre Funktionen weitergibt, kann man sicher diskutieren. Und auch das Verb „σχίζειν“ (schízein), das eine regelrechte „Spaltung“ der Psyche andeutet, würde man infolge jüngerer Erkenntnisse über das Krankheitsbild vielleicht heute nicht mehr wählen.
Im Grunde ist es aber eh egal, weil heute kaum noch jemand so gut Griechisch versteht, dass Missverständnisse aufkommen könnten.
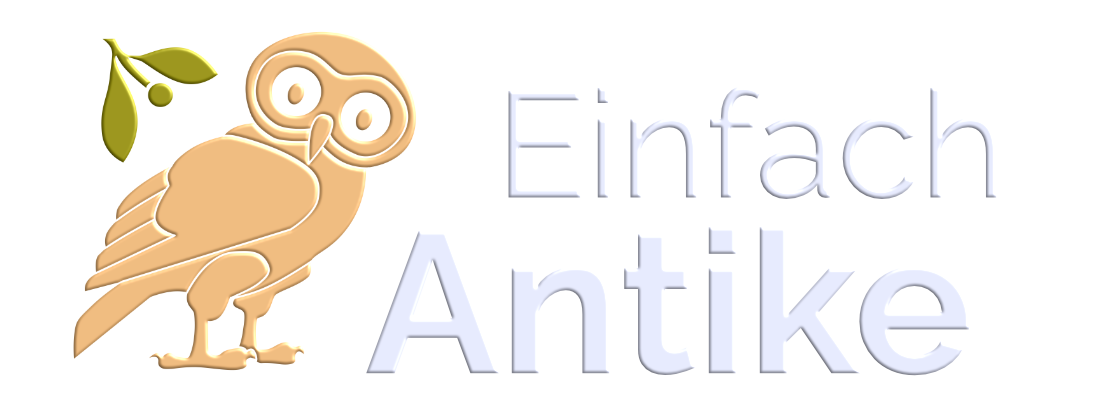
Schreibe einen Kommentar